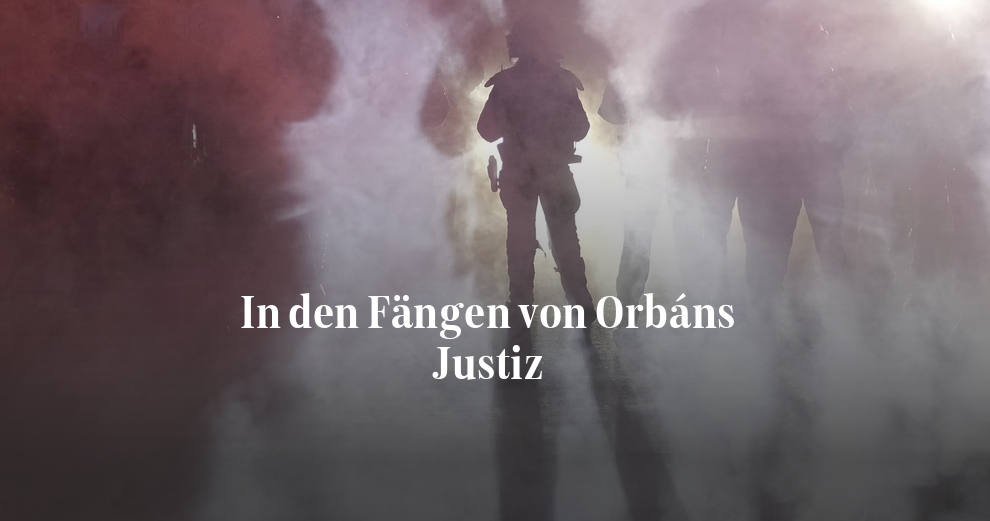Artikel aus der Süddeutschen Zeitung
Manchmal vergehen Stunden, bis der Anruf aus dem Gefängnis kommt. Er sitzt dann in seiner Küche, blättert in Dokumenten und den Briefen, die ihm sein Kind aus Budapest geschickt hat, die Seiten eng beschrieben, inzwischen ist der Stapel fast daumendick. Es kam schon vor, dass er hier vergeblich saß, stundenlang.
Ein Tag im Januar, Wolfram Jarosch sitzt wieder mal in seiner Küche in Jena und wartet. Vor ihm eine Tasse schwarzer Tee. Es klingelt, unbekannter Anrufer, er greift nach dem Telefon. „Ja, hallo. Maja?“, sagt er. „Hallo Papa“, sagt Maja T.
Der Ton ist dumpf und leise, der Empfang immer wieder gestört. Die Stimme klingt brüchig, fast tastend. 80 Minuten Zeit habe Maja T. jede Woche, um aus der Zelle in einem Gefängnis in Budapest mit ausgewählten fünf, sechs Kontakten zu telefonieren, sagt Wolfram Jarosch. Mit den Eltern, den Geschwistern, dem Anwalt, mit niemandem sonst. „Ich spüre die körperliche und mentale Erschöpfung“, sagt Maja T. jetzt zum Vater. „Sieben Monate ohne Sonne und in Isolationshaft.“ Kein Aufseher ist im Hintergrund zu hören, keine Stahltür, die zugeschlagen wird. Der Alltag im Gefängnis ist keine Netflix-Serie, er ist vor allem monoton.
Maja T. ist 24 Jahre alt und identifiziert sich als non-binär, was das Leben in ungarischer Haft nur unter Männern nicht leichter macht. In der Zelle sind zwar keine anderen Menschen, dafür gebe es Kakerlaken, Bettwanzen, Ungeziefer, sagt Maja T. Dass das ungarische Justizministerium im Jahr umgerechnet bis zu 125 000 Euro für Schädlingsbekämpfung in Gefängnissen ausgibt, wie es selbst sagt, davon merkt Maja T. eher wenig.
23 Stunden am Tag ist Maja T. allein in der Zelle, eine Stunde an der frischen Luft. „Meine Augen werden schlechter, mein Körper altert.“ Nur durch ein kleines, mit Folie beklebtes Fenster komme Licht in die Zelle. Fast jeden Tag der gleiche Tagesablauf, dieselbe Routine, kaum Kontakt zu anderen. Wolfram Jarosch hört seinem Kind zu, sein Mund ist ein Strich. Inzwischen lerne Maja T. Ungarisch, um die Aufseher zumindest ein bisschen zu verstehen.
Seit etwa dreizehn Monaten ist Maja T. jetzt in Untersuchungshaft, erst in Deutschland, dann in Ungarn. Das mag zermürbend gewesen sein, aber an der politischen Überzeugung hat all das offenbar nichts geändert: „Wie kann es sein“, sagt Maja T. jetzt fast trotzig, „dass es jedes Jahr möglich ist, dass Tausende Neonazis durch Budapest marschieren, Angst verbreiten, Verbrechern huldigen – und das alles unterstützt wird vom ungarischen Staat?“ Dann ist das Gespräch vorbei. In der Küche ist jetzt Stille.
Wolfram Jarosch bleibt erst mal sitzen, 54 Jahre ist er alt, Chemie- und Biologielehrer, ein Mann von nüchterner Sachlichkeit. Er sitzt vor seiner Tasse Tee, ratlos. Als Maja T. im Juni nach Ungarn ausgeliefert wurde, stieg er in den nächsten Nachtzug, brachte dem Kind Klopapier und ein Handtuch ins Gefängnis. „Wie man sich abtrocknet? Das interessiert die nicht“, sagte er damals, im Juli, als er vor dem wuchtigen Gefängnisgebäude stand, die Stirn wächsern von der Hitze. Er rückte ganz nah heran mit dem Gesicht an eines der vergitterten Fenster, irgendwo hinter diesen Mauern musste sein Kind sein. Fast sechs Wochen blieb er in der Stadt, dann waren die Sommerferien vorbei. Zu den Vorwürfen gegen Maja T. will Jarosch nichts sagen, nur so viel: „Wenn das eigene Kind in so einer Situation ist, tut man alles, um da irgendwie da zu sein.“
Am 21. Februar könnte Maja T. aus dem Alltag in der Haft gerissen werden. Nur ist noch völlig offen, ob die Dinge für T. dann besser oder schlechter werden. An diesem Tag beginnt der Prozess in Budapest. Der Vorwurf: T. soll zusammen mit zehn anderen Personen im Februar 2023 in Budapest mehrere mutmaßliche Neonazis überfallen und teils schwer verletzt haben.
Die ungarischen Ermittler haben rekonstruiert, wie die Angriffe der Linksradikalen auf die Rechtsradikalen abliefen: Die Gruppe um Maja T. soll Paaren aufgelauert oder Dreiergruppen verfolgt haben, die Flecktarn trugen, einschlägige Tätowierungen hatten oder die gerade von einem Rechtsrock-Konzert kamen. Leute, die sie für Neonazis hielten. Immer schlugen die Angreifer mit einer Übermacht zu: acht, neun, zehn Leute gegen einen, zwei oder drei. 30 Sekunden Angriff, dann Abzug. Eine gab das Kommando, einer hinderte Passanten am Eingreifen. Das „Zugriffsteam“ schlug den Überfallenen mit Teleskopstöcken auf den Kopf, auf die Brust, es sprühte den Opfern Pfefferspray ins Gesicht. Noch am Boden setzte es Fußtritte.
Am „Tag der Ehre“ führen junge Männer voller Stolz die SS-Uniformen ihrer Urgroßväter aus
Es gibt mehrere Videos von den Übergriffen im Februar 2023, auf denen man sehen kann, wie wuchtig die Schläge waren. Das Ergebnis: Trümmerbrüche, Schädelfrakturen, Gehirnerschütterungen bei den überfallenen Opfern. Einer Frau wurde der Unterarm zertrümmert, einem Mann der Jochbogen und die Augenhöhle, einem dritten die Fingerglieder. Alle hatten sie Platzwunden. Insgesamt soll die Gruppe um Maja T. um den „Tag der Ehre“ herum fünf Überfälle mit neun Verletzten begangen haben in Budapest.
Vierundzwanzig Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft in Budapest für Maja T., bei einem Geständnis am ersten Tag vierzehn Jahre. Vierzehn Jahre – das ist ungefähr zwei- bis dreimal so viel wie das, was deutsche Gerichte für solche Taten verhängen würden.
Der „Tag der Ehre“ ist ein Hochfest der europäischen Neonazi-Szene, seit Jahren Treffpunkt der gewaltbereiten „Blood and Honour“-Vereinigung, von Hammerskins, Combat 18, mit Konzerten, auf denen offen Hakenkreuze und Hitlergruß gezeigt werden. Junge Männer führen da bei Aufmärschen voller Stolz die SS-Uniformen ihrer Urgroßväter aus, sie marschieren in Knobelbechern, schweren Armeestiefeln, wie sie die Wehrmacht trug, und mit Stahlhelm auf dem Kopf durch die Straßen. Niemand schreitet ein. Jeder kann hier den Hitlergruß zeigen. Die ungarische Polizei ist nur darum bemüht, dass Links- und Rechtsextreme nicht aufeinander losgehen.
Erinnert wird von den Neonazis am „Tag der Ehre“ an ein historisches Ereignis: Als Budapest Anfang 1945 von der Roten Armee eingekreist war, versuchte die Wehrmacht unter Leitung eines SS-Generals und mit ungarischen Unterstützern einen letzten verzweifelten Ausfall aus der Belagerung. Er gelang nicht. Die Schlacht um Budapest endete am 13. Februar 1945, insgesamt waren 30 000 Deutsche und 17 000 Ungarn gefallen, auf der anderen Seite 80 000 russische und rumänische Soldaten.

Es ist mehr als befremdlich, jedes Jahr Tausende Neonazis in SS-Uniformen durch Budapest marschieren zu sehen.
Aber: Man prügelt nicht auf Menschen ein, egal, welche Gesinnung sie haben. Gewalt bleibt Gewalt, auch wenn sich die mutmaßlichen Täter als Antifaschisten sehen, die Europa gegen den Aufmarsch der Rechtsradikalen verteidigen wollen. Und ja, diese Taten müssen geahndet werden.
Trotzdem stellt sich die Frage: Darf der deutsche Staat seine eigenen Bürger an ein Land wie Ungarn ausliefern? Muss er nicht selbst die Prozesse gegen die Verdächtigen führen? Und ist eine Auslieferung von Verdächtigen aus der linken Szene in ein autoritär rechts geführtes System nicht von vornherein mit rechtsstaatlichen Risiken verbunden? Kann ein Land wie Ungarn, gegen das die EU-Kommission immer wieder Strafen wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit verhängt, überhaupt ein gerechtes Verfahren garantieren?
Das für Maja T. damals zuständige Kammergericht Berlin fand: Ja. Als die ungarischen Justizbehörden per europäischem Haftbefehl die Überstellung von Maja T. nach Budapest verlangten, erklärte das Kammergericht, es bestünden keine rechtlichen Hindernisse. Am 27. Juni 2024, um 17.26 Uhr, ging die Entscheidung des Kammergerichts bei den Anwälten von Maja T. ein. Die reichten sofort Verfassungsbeschwerde dagegen ein – am nächsten Morgen um 7.38 Uhr lag die Beschwerde dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor. Und die Richter dort entschieden um 10.50 Uhr: Stopp. Die Auslieferung hat zu unterbleiben. Schneller geht es im deutschen Rechtssystem kaum.
Auch Verfassungsrichter lesen Zeitung. Sie wissen, was in Ungarn los ist. Doch noch bevor das Bundesverfassungsgericht überhaupt reagieren konnte, wurde Maja T. um zwei Uhr morgens aus der Zelle in Dresden geholt und durch Beamte des Landeskriminalamts Sachsen per Hubschrauber zu dem kleinen Flughafen Vilshofen nahe der österreichischen Grenze gebracht. Von dort wurde T. den österreichischen Behörden übergeben, morgens um zehn Uhr war Maja T. dann in Ungarn. Die Auslieferung war vom Landeskriminalamt Sachsen offenbar generalstabsmäßig vorbereitet worden. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe hatten keine Chance.
Die Überstellung von Maja T. war offenbar generalstabsmäßig vorbereitet worden
Die Verfassungsrichter störten sich vor allem daran, dass das Kammergericht Berlin den Beteuerungen der Ungarn, die Haftbedingungen seien auf europäischem Standard, einfach so Glauben geschenkt hatte. Denn es gibt ja seit Jahren Klagen. Die italienische EU-Abgeordnete Ilaria Salis, die 2023 ebenfalls wegen Übergriffen am „Tag der Ehre“ festgenommen worden war, hat erzählt, wie es ihr in ungarischer Haft erging: Bettwanzen in der Zelle, nur vier Rollen Klopapier im Monat und ein Büschel Baumwolle für die Menstruation. Sie war bei Prozessbeginn an Händen und Füßen in Ketten und an einer Leine vorgeführt worden. Italiens rechtspopulistische Regierungschefin Giorgia Meloni hatte sich für Salis eingesetzt. Frei kam Ilaria Salis dann aber nur, weil sie aus der Haft heraus ins Europäische Parlament gewählt wurde. Dadurch besitzt sie Immunität.
Auf den Videos von den Überfällen auf die Neonazis 2023 konnten die ungarischen Behörden immer mehr Verdächtige identifizieren. Und viele der deutschen Gesuchten tauchten auch gleich unter. Denn die ungarische Justiz schickte europäische Haftbefehle nach Deutschland. Einer der ersten war der gegen Maja T. Es war ein Schock für die Szene, als T. im Sommer 2024 ausgeliefert wurde. Unter den Untergetauchten wuchs die Angst, dass sie alle nach Ungarn ausgeliefert werden, wenn sie sich stellen.
Und es ist ja auch nicht ganz einfach: Das Tatort-Prinzip steht hier gegen das Prinzip, dass Deutschland Straftaten von Deutschen im Ausland selbst verfolgen kann. Entsprechend einer EU-Leitlinie hat das Tatort-Prinzip Vorrang. Dafür sprechen praktische Gründe: Meist gibt es am Tatort Zeugen, Videos – die sonst umständlich und per Rechtshilfeersuchen nach Deutschland gebracht werden müssten.
Am 20. Januar 2025 haben sich dann trotzdem sieben untergetauchte Frauen und Männer aus dem Budapest-Komplex der deutschen Justiz gestellt. „Ein mutiger Schritt“, sagt die Berliner Anwältin Antonia von der Behrens, die eine der sieben vertritt. Denn die europäischen Haftbefehle gegen sie sind ja weiter in Kraft, ein Gericht könnte ihre Auslieferung beschließen – trotz des Stopps durch das Verfassungsgericht im Fall von Maja T.
„Wir haben das Gefühl, dass hier ein Exempel statuiert werden soll“, sagt von der Behrens. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, die das Verfahren gegen die sieben am Anfang führte, habe versucht, die Frage der Auslieferung mit Geständnissen zu verknüpfen, und habe so Druck auf die Untergetauchten machen wollen. „Aber das hat meine Mandantin nicht mitgemacht“, sagt die Anwältin. Und die anderen offenbar auch nicht.
Das Bundesverfassungsgericht sieht das ähnlich. In einer endgültigen Entscheidung zur Auslieferung von Maja T. hat es am 6. Februar 2025 entschieden, dass die Auslieferung rechtswidrig war und dabei vor allem auf die gender-, homo- und transfeindliche Politik in Ungarn verwiesen sowie auf die schlechten Haftbedingungen. Die Italiener sahen das von Anfang an so: Die Mailänder Justiz hat einen jungen Italiener, der ebenfalls bei den gewalttätigen Übergriffen am „Tag der Ehre“ dabei war und von Ungarn mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde, nicht an das Land ausgeliefert. So viel Kritik von allen Seiten hat offenbar etwas bewegt.
Als Maja T. am Morgen des 28. Juni 2024 nach Ungarn überstellt wurde, hatte die deutsche Bundesanwaltschaft nichts dagegen. Jetzt aber schwenkt sie um. Wie die SZ erfuhr, hat die oberste deutsche Anklagebehörde am 31. Januar an die für Auslieferungen zuständigen Generalstaatsanwaltschaften geschrieben. Die deutschen Ermittlungen gegen die Gesuchten aus dem Budapest-Komplex seien vorrangig, heißt es darin. Das bedeutet: Die Personen, die sich jetzt gestellt haben, werden nicht nach Ungarn ausgeliefert. Ihnen wird in Deutschland der Prozess gemacht. Nur ein in Deutschland lebender Syrer, der ebenfalls bei den Übergriffen dabei war, soll offenbar an Ungarn ausgeliefert werden. Er sitzt schon in Auslieferungshaft.
Selbst das von Meloni regierte Italien hat eine Auslieferung abgelehnt
Einer der deutschen Prozesse rund um den Budapest-Komplex geht auch schon bald los, am 19. Februar in München, gegen Hanna S., 30, Kunststudentin aus Nürnberg. Auf dem Platz vor dem Oberlandesgericht steht jetzt Jakob G., ihr Verlobter, ein ruhiger Mann von 42 Jahren, Musiker aus Nürnberg, er will sich ansehen, wo demnächst gegen seine Verlobte verhandelt wird. Auch Hanna S. war in Budapest dabei, auch sie soll auf ein Neonazi-Paar eingeschlagen haben, mit Schlagstöcken und einem kleinen Hammer. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, sie habe unmittelbar dazu angesetzt, einen anderen Menschen aus niedrigen Beweggründen heimtückisch zu töten. Das wäre versuchter Mord. Sie soll einzelne Neonazis auch ausgespäht und sie festgehalten haben, während die anderen zuschlugen. Bei zwei der Überfallenen hätte der Angriff auch tödlich enden können, heißt es in der Anklage. Hanna S. ist erst spät auf den Tatvideos identifiziert worden, gegen sie haben die Ungarn gar keinen europäischen Haftbefehl mehr an Deutschland übermittelt. Also wird gegen sie in München verhandelt.
„Natürlich ist sie eine politische Person“, sagt Jakob G., das schon. Aber eine Gewalttäterin? Er hat sogar eine Mappe mitgebracht, darin Fotos der jüngsten Werke von Hanna S.: ein Fußabtreter, aus echtem Frauenhaar gewebt. Ein Hemdchen aus Papier, gestrickt aus den aufgedröselten Akten ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung bei der Polizei. Ein Werk aus Wollfäden als Erinnerung an die von Neonazis Getöteten seit 1945.
„Hanna rennt nicht gewaltbereit und schwarz vermummt durch die Gegend. Sie lehnt die Grundordnung der Bundesrepublik nicht ab“, sagt ihr Verlobter Jakob G., „so ist sie nicht.“ Deswegen ist Hanna S. aber angeklagt, sie gehöre zu einer militant antifaschistischen Gruppe und lehne das Gewaltmonopol des Staates ab, so steht das in der Anklage der Bundesanwaltschaft. Das Oberlandesgericht München hat allerdings bereits erklärt, Hanna S. könnte statt wegen versuchten Mordes auch nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden. Das entscheidet das OLG München mit Urteil am Ende des Prozesses.
Offenbar dimmen jetzt auch andere Richter die Vorwürfe gegen die Budapest-Verdächtigen herunter. Die Ermittlungsrichterin beim Bundesgerichtshof hat die von der Bundesanwaltschaft beantragten Haftbefehle gegen die Untergetauchten aus der linksradikalen Szene ebenfalls nicht wegen versuchten Mordes ausgestellt. Es gebe keinen Hinweis, dass die Gruppe es auf die Tötung von Menschen abgesehen habe. Die Bundesanwaltschaft hat Hanna S. in München trotzdem wegen versuchten Mordes angeklagt.
Denn es geht ja nicht nur um Hanna S. und Maja T., es geht um einen größeren Komplex. Bereits im Mai 2023 wurde Lina E. verurteilt, vor dem Oberlandesgericht Dresden – zu fünf Jahren und drei Monaten Haft wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und mehrfacher gefährlicher Körperverletzung. Sie stand laut Urteil des Oberlandesgerichts Dresden hinter acht Überfällen auf Rechtsradikale rund um Leipzig. Diese Überfälle wurden nach dem gleichen Muster begangen wie die Übergriffe am „Tag der Ehre“ in Budapest. Seit 2018 gingen die sächsischen Linksradikalen mit Hammer und Schlagstock auf Rechtsradikale los. Auch die Kommunikation dort funktionierte genauso wie in Budapest: über Safe-Handys, mit SIM-Karten, die auf nicht existente Personen registriert waren.
In der linken Szene werden Maja T., Hanna S. und die anderen gefeiert wie Märtyrer
Die linke Szene feiert Maja T., Hanna S. und die anderen seit Monaten wie Märtyrer. Auf den Bühnen von Punk-Konzerten brandet Jubel auf, wenn ihre Namen erwähnt werden, die Leute werden aufgerufen, den Gefangenen Briefe ins Gefängnis zu schreiben, damit sie durchhalten. Als Hanna S. im November in der Zelle ihren 30. Geburtstag feierte, gab es vor den Gefängnismauern in Nürnberg ein Konzert für sie. Dort, wo die linke Szene stark ist, in Jena oder Leipzig, gibt es in manchen Straßenzügen kaum noch Fassaden ohne Graffiti wie „Free Maja“ und „Free Hanna“.
Tamás Bajáky, dem ungarischen Anwalt von Maja T., ist dieser Pathos fremd. Er sieht die Dinge eher nüchtern – und pessimistisch. Am Telefon sagt er, dass ihm die Vorbereitung auf den Prozess erschwert werde. Viele der Dokumente seien bis jetzt nur in ungarischer Sprache und damit für Maja T. nicht lesbar. Darüber hinaus befürchtet Bajáky, dass sich der Prozess ziehen werde. „Nach meiner vorläufigen Einschätzung könnte das erstinstanzliche Gerichtsverfahren etwa ein Jahr dauern.“
Auch planbar sind die Verfahren kaum. Oft werde erst am Ende eines Prozesstages bekannt gegeben, wann weiterverhandelt wird, sagt Bajáky. Das kann, wenn es gut läuft, in der darauffolgenden Woche sein, aber auch erst im nächsten Monat oder in einem halben Jahr.
Sicher ist nur eines: Solange es kein Urteil gibt, bleibt Maja T. in Ungarn.